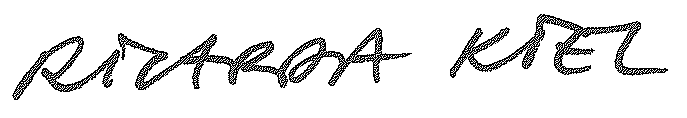Autobiographisches Schreiben
Odile Kennel in LUST
Aber kann ich mich überhaupt mit irgendetwas ohne meine persönliche Geschichte auseinandersetzen? … eine andere Vergangenheit hab ich nicht. Ich setz mich ganz weit weg! Ich rücke ganz nah ran! Wo ist sie hergekommen, die Lust, die Lust auf Welt, auf Körper, auf Text? Wann und weshalb hat sie mich überkommen? Was war der Preis? Was gebe ich preis? Wie viel Ich stecke ich in den Text?*
In meinem Buch Tante Alles schreibe ich zum ersten Mal ziemlich direkt aus meinem Leben. Zum Teil in stark verdichteter, lyrischer Form, zum Teil aber auch in ausführlichen, tagebuchartigen Prosastücken. Ich erzähle darin von meinem Umgang mit dem Begriff Tante, als leibliche Tante meines verstorbenen Neffens und als Wahltante meines lebenden Patenkindes, von meinem endlosen Kreisen um die Frage, ob und wie ich selber ein Kind haben möchte, von meiner Erfahrung mit einer Fehlgeburt und von dort wieder zurück zu der Frage, wie und mit welchen Modellen ich als queere Person Familie leben will und kann. Themen also, die sehr viele Menschen betreffen und über die trotzdem vergleichsweise wenig literarisch geschrieben wird.
Autobiographisches Schreiben, das für eine Öffentlichkeit gedacht ist, stellt mich vor andere Herausforderungen als fiktionales oder stark abstrahiertes Schreiben.
Es gibt ziemlich offensichtliche Fragen dabei, zum Beispiel, wie ich angemessen die Teile meiner Geschichte erzählen kann, die eigentlich zur Geschichte anderer Menschen in meinem Leben gehören, ohne ihnen die Geschichte zu klauen, ohne sie zu verwischen, ohne sie auszustellen.
Oder auch: Wie erzähle ich das so, dass es auch für Menschen relevant ist, die mich nicht persönlich kennen, ohne etwas zu überdramatisieren oder in zu grelles Licht zu rücken? Wann ist es „Betroffenheitsliteratur“, wann will ich andere treffen, wann erlaube ich mir, sichtbar getroffen zu sein?
Überraschender waren für mich andere Fragen: Wie gehe ich mit meiner eigenen Veränderung um, wie bilde ich also ab, dass sich alles, was ich fühle und denke, auch wieder verändern kann und oft bereits verändert hat? Der einzelne Text ist ja immer nur ein Punkt in einem Prozess, in einem Buch benimmt er sich schnell wie die Wahrheit.
Dazu gehört auch die Frage: Wie sehr bin ich bereit, meine eigenen Denkverstrickungen und meine eigene, zu dem Moment gehörende, Dummheit sichtbar zu machen? Wann unterliege ich der Versuchung, diese Stellen im Rückblick zu glätten, mir kleine Löcher in den Text zu bohren, aus denen ich mich herauswinden kann?
Und: Was von dieser Erzählung ist Selbstmythisierung, und wann ist die ein guter, stützender Rahmen für solche Texte, und wann ist das eine Decke, die die eigentliche Geschichte erstickt? Wann schnüre ich am Ende den Text zu fest zu?
Wann schlachte ich mein Erlebtes selber aus? Wann rutscht der Wunsch, mit der eigenen Erzählung die Erzählung anderer anzustoßen, zu dem Wunsch, Profit zu ziehen aus dem, was ich eh durchleben musste?
(Der Löffeltext war eine gute Übung für dieses Abwiegen, und die Hier-ist-etwas-Briefe sind regelmäßige kleine Übungen im Schreiben aus meinem Leben – was mir überraschend spät auffällt.)
Vielleicht ist das Hinausgehen mit einem Text dann richtig, wenn es sich anfühlt wie ein Teilen („Hier ist etwas, das ich erfahren und durchlebt habe“) und ich dabei das, was ich teile, selber halten kann. Ich muss es nirgendwo hinwerfen, nicht von mir schleudern, nicht loswerden, sondern ich kann es mit sicherer Hand halten und andere einladen, Fäden davon aufzunehmen und weiter zu weben.
•
You are the only thing you have to offer, and you must offer yourself to the world in a true way.
•
I see myself and my life each day differently. What can I say? The facts lie. I have been Don Quixote, always creating a world of my own. I am all the women in the novels, yet still another not in the novels. It took me more than sixty diary volumes until now to tell about my life. Like Oscar Wilde I put only my art into my work and my genius into my life. My life is not possible to tell. I change every day, change my patterns, my concepts, my interpretations. – Anaïs Nin in einem Brief, in dem sie ablehnte, eine kurze Autobiographie für ein Profil in Harper’s Bazaar zu schickenUnd die Frage, ob wir nicht eh so flüssige Wesen sind, dass wir uns gar nicht in Texten festhalten können (falls das der Versuch war). Dass die in den Text gebohrten Löcher, aus denen ich mich herauswinden kann, also die Hauptsache sind.
•
Gelegentlich die Sorge, dass autofiktionale Texte als eine Art von Bedienungsanleitung für das eigene Selbst missverstanden werden könnten, aber LOL wer glaubt denn wirklich eine dieser Maschinen bedienen zu können.
•
Zu diesen (interessanten) handwerklichen Fragen gesellen sich die (öden) Fragen des Betriebs, der mal mehr von dieser Art Literatur verlangt, mal mehr von jener, der behauptet, seit Knausgard schreiben „alle“ autofiktional, was immer das auch heißen mag, das weiß kein Mensch so richtig, der arrogante kleine Sätze wie Ohrfeigen verteilt („endlich mal ein Buch, in dem uns ein Autor nicht aus seinem Leben erzählt“), dieser Betrieb, der sich so viel auf seine Neugier einbildet und sich doch immer so schnell langweilt.
siehe auch Scham, Betroffenheit, Narrative Identität und die Berechtigung, über sich selbst zu schreiben